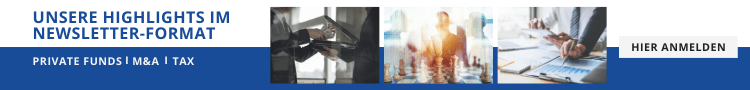Mit einer jüngeren Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (Urteil vom 29.6.2022, Az. IV ZR 110/21) die Anforderungen an die Anwendung ausländischen Erbrechts im Hinblick auf das Pflichtteilsrecht konkretisiert. Dieses Urteil sollte bei der internationalen Nachfolgeplanung wie auch bei Eintritt eines Erbfalls mit grenzüberschreitenden Bezügen zu Deutschland berücksichtigt werden.
In dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall hatte der Erblasser wirksam englisches Recht als auf seinen Todesfall anwendbares Recht gewählt. Der Bundesgerichtshof entschied jedoch, dass nicht das gewählte Recht, sondern stattdessen deutsches Recht in Bezug auf das Pflichtteilsrecht Anwendung finde. Das Gericht begründete dies mit einem Verstoß des englischen Rechts gegen die deutsche öffentliche Ordnung (ordre public), weil jenes in diesem Fall keine ausreichende Pflichtteilsberechtigung gewähre.
Das Wichtigste in Kürze
- Erblasser, die über eine fremde Staatsangehörigkeit verfügen, dürfen grundsätzlich das Recht ihres Heimatstaates als auf den Erbfall anwendbares Recht wählen. Trifft ein Erblasser keine Rechtswahl, kommt vor deutschen Gerichten grundsätzlich das Erbrecht des Staates zur Anwendung, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
- Ein deutsches Gericht versagt jedoch die Anwendung des fremden Rechts, wenn diese zu einer Verletzung der deutschen öffentlichen Ordnung (ordre public) führt. Ein solcher Verstoß gegen den deutschen ordre public kann vorliegen, wenn das fremde Recht kein nach festen Quoten bestimmtes und bedarfsunabhängiges Pflichtteilsrecht der Abkömmlinge vorsieht. Eine Kompensation durch nicht äquivalente Ersatzmechanismen – bspw. die bedarfsabhängige Beteiligung nach englischem Erbrecht – genügt nicht.
- Weitere Voraussetzung der Nichtanwendung des ausländischen Rechts – und der regelmäßigen Anwendung des deutschen Rechts an dessen Stelle – ist eine hinreichend starke Inlandsbeziehung des Sachverhaltes. Deren genaue Ausgestaltung lässt der Bundesgerichtshof offen. Jedenfalls soll sie vorliegen, wenn sowohl der Erblasser als auch der Pflichtteilsberechtigte seit Langem in Deutschland leben.
Rechtlicher Hintergrund
Die Bestimmung des anwendbaren Rechts bei einem Erbfall richtet sich in Deutschland, wie in den meisten EU-Ländern, nach der Europäischen Erbrechtsverordnung (EuErbVO). Demnach kann auch ausländisches Erbrecht vor einem deutschen Gericht zur Anwendung kommen. Dies ist u.a. der Fall, wenn ein deutsches Gericht mit einem Fall befasst ist, in dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Staat hatte (Art. 21 EuErbVO). Ebenfalls kommt es zur Anwendung ausländischen Rechts, wenn der Erblasser über eine fremde Staatsangehörigkeit verfügte und das Recht dieses Heimatstaates als auf den Todesfall anwendbares Recht wählte (Art. 22 EuErbVO).
Für die Anwendung des fremden Rechts existiert indes eine Schranke: die offensichtliche Unvereinbarkeit jenes Rechts mit der öffentlichen Ordnung (ordre public) des Staates des angerufenen Gerichts, bei einem deutschen Gericht also der deutschen öffentlichen Ordnung (Art. 35 EuErbVO). In diesem Fall kann das Gericht die Anwendung des fremden Rechts versagen. Dies gilt auch, wenn der Erblasser dieses Recht wählte.
Sachverhalt der Entscheidung
Der Entscheidung des Bundesgerichtshofes lag folgender Fall zugrunde: Der Erblasser war britischer Staatsangehöriger, der bis zu seinem Tod seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland lebte. Der Erblasser wählte mit seinem Testament das englische Recht als das für seine Rechtsnachfolge von Todes wegen anwendbare Recht. Der enterbte Sohn und Kläger war für die von ihm gegen die testamentarisch eingesetzte Erbin geltend gemachten Ansprüche auf die Berufung auf ein Pflichtteilsrecht angewiesen. Das deutsche Recht sieht ein nach festen Quoten bestimmten und bedarfsunabhängigen Anspruch bestimmter Angehöriger und des Ehegatten vor, die vom Erblasser enterbt wurden. Im englischen Recht besteht dagegen nur eine enger verstandene, bedarfsabhängige Pflichtbeteiligung am Nachlass nach dem Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.
Das deutsche Pflichtteilsrecht hätte an sich wegen der Wahl des englischen Rechts nicht weitergeholfen. Doch der Bundesgerichtshof entschied, dass das englische Recht trotz der wirksamen Rechtswahl keine Anwendung finde, weil es in diesem Fall keine ausreichende Pflichtteilsberechtigung gewähre. Dies stelle einen Verstoß gegen den deutschen ordre public dar.
Das Pflichtteilsrecht als Grenze der Anwendung – auch durch den Erblasser gewählten – fremden Erbrechts
Nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofes sei das Pflichtteilsrecht Teil des deutschen ordre public. Denn es handele sich aufgrund der konstitutionellen Erbrechtsgarantie (Art. 14 Abs. 1 S. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG) bei dem Pflichtteilsrecht der Kinder um eine grundrechtlich geschützte Position. Dies sei eine Grenze der im Ausgangspunkt gewährten Testierfreiheit. Der Bundesgerichtshof bezog sich dabei auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes.
Das englische Recht gewähre dagegen nach dem Verständnis des Gerichtes dem Kläger im vorliegenden Fall kein nach festen Quoten bestimmtes und bedarfsunabhängiges Pflichtteilsrecht. Das so verstandene englische Recht erfülle nach dem Bundesgerichtshof nicht die an ein fremdes Recht durch den deutschen ordre public gestellten Mindestanforderungen: nämlich eine bedarfsunabhängige Mindestbeteiligung der Kinder am elterlichen Nachlass.
Dies könne auch nicht durch Ersatzmechanismen des fremden Rechts kompensiert werden, die dahinter zurückbleiben. In dem entschiedenen Fall sei dies nach englischem Recht eine bloße, von bestimmten Voraussetzungen abhängige, gerichtliche Ermessensentscheidung über die Gewährung eines Ausgleichsanspruches.
Voraussetzung für die Nichtanwendung des fremden Rechts sei schließlich eine hinreichend starke Inlandsbeziehung des Sachverhaltes. Dies sei bei einem in Deutschland belegenen Mittelpunkt der durch den ordre public geschützten Familienbeziehungen der Fall. Dabei berücksichtigte der Bundesgerichtshof den gewöhnlichen Aufenthalt von Erblasser und Pflichtteilsberechtigtem in der Zeit vor dem Erbfall und bei dessen Eintritt, die Belegenheit des Nachlasses sowie die Staatsangehörigkeit des Pflichtteilsberechtig-ten.
Folge: Anwendung des deutschen Rechts
Als Folge des Verstoßes gegen den deutschen ordre public sei nach dem Bundesgerichtshof das deutsche Pflichtteilsrecht in vollem Umfang anzuwenden. Eine bloße Nichtanwendung bestimmter Normen und einer Lückenschließung unter Zuhilfenahme des fremden Rechts komme nur in Betracht, wenn entsprechende Regelungen überhaupt existierten.
Folgen für die Praxis
Die vom Bundesgerichtshof aufgestellten Anforderungen bedeuten für Erblasser eine Begrenzung der Gestaltungsoptionen zur Verhinderung von Pflichtteilsansprüchen, insbesondere durch Rechtswahl. Für enterbte Familienangehörige eröffnen sich hingegen Möglichkeiten zur Geltendmachung von Pflichtteilsansprüchen vor deutschen Gerichten.
Die Entscheidung sollte indes nicht so verstanden werden, dass generell jeder enterbte Familienangehörige oder Ehegatte, solange ein deutsches Gericht zuständig ist, den Pflichtteil erzwingen kann. Dies zeigt sich insbesondere am Erfordernis des hinreichenden Inlandsbezugs, der im vorliegenden Fall recht deutlich gegeben war. Leider hat der Bundesgerichtshof hier aber keine Rechtssicherheit geschaffen, wo die Grenze eines derartigen Inlandsbezugs verläuft: Reicht bereits die Ansässigkeit des Pflichtteilsberechtigten in Deutschland oder sogar die Belegenheit der Nachlassgegenstände in Deutschland?
Die Nachlassplanung bei grenzüberschreitenden Erbfällen mit Berührungspunkten mit Deutschland sollte sich mithin diesen Anforderungen hinsichtlich eines Pflichtteilsrechts bewusst sein, zugleich aber die verbleibenden Optionen nicht außer Acht lassen. Insbesondere dürfte es sich empfehlen, alternative Wege zur Vermeidung von Pflichtteilsansprüchen in Deutschland in Betracht zu ziehen. Dies können idealerweise Pflichtteilsverzichte sein oder auch die Minimierung eines späteren Pflichtteilsanspruchs durch lebzeitige Schenkungen. Das deutsche Pflichtteilsrecht berücksichtigt dabei jedoch in einem 10-Jahres-Zeitraum vor dem Erbfall erfolgte Schenkungen, die den späteren Nachlass mindern. Innerhalb dieses Zeitraumes wird die Schenkung entsprechend ihrer zeitlichen Nähe zum Erbfall in jährlichen Abstufungen nur anteilig berücksichtigt. Bei einem Nießbrauchvorbehalt oder einer Schenkung an den Ehegatten kann es indes dazu kommen, dass die anteilige Reduktion vollständig unterbleibt.